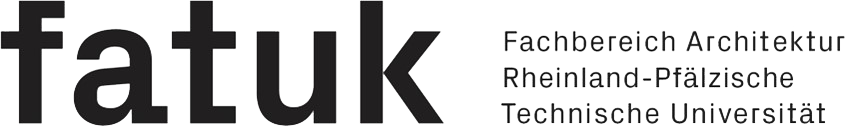Abbildung: Taleinfahrt Diemerstein, Foto: Andreas Labes
Werk- und Forschungshalle, Campus Diemerstein
Mit der Werk- und Forschungshalle in Diemerstein wurde ein zukunftsweisender Holzbau realisiert, der konsequent nach Prinzipien der Kreislauffähigkeit entwickelt und vollständig rückbaubar konstruiert wurde. Das Projekt ist Teil der Strategie des t-lab Holzarchitektur und Holzwerkstoffe am Fachbereich Architektur der RPTU Kaiserslautern, innovative Konstruktionsweisen direkt mit der Lehre und praktischer Umsetzung im Maßstab 1:1 zu verbinden.
Die Halle wurde im Rahmen eines „Research-Design-Build“-Prozesses entworfen, geplant und gebaut – maßgeblich durch Studierende unter fachlicher Anleitung. Sie bildet das Herzstück des entstehenden Holzbau-Campus im Diemersteiner Tal und fungiert als multifunktionaler Lern- und Forschungsort: als Werkstatt, Veranstaltungsort, Lehrraum und Bauplatz für Mockups und Prototypen.
Beitrag des SWR zum Holzcampus
Hier klicken um zum SWR-Beitrag zu gelangen!
Videobeitrag Deutschen Ingenieurbaupreis 2024
Fimcredit: © HELLO STUDIO W
Abbildung: Innenraum Werkhalle, Foto: Andreas Labes
Lernort, Werkstatt, Raum für Ideen
Im Inneren bietet die Halle eine freie Fläche von ca. 360 m², ergänzt durch eine freistehende Funktionsbox mit Nebenräumen (Teeküche, Lager, WC, HAR, Garderobe). Die Ausstattung mit Werkbänken und Holzbearbeitungsmaschinen ermöglicht praktisches Arbeiten im Rahmen von Seminaren, Projektwochen und Forschungsvorhaben. Veranstaltungen, Tagungen oder Ausstellungen können flexibel in der Halle stattfinden.
Die Halle ist nicht nur ein Gebäude – sie ist ein Lern- und Möglichkeitsraum. Ihre klare Struktur, das offene Tragwerk und die sichtbaren Fügungen machen sie zu einem anschaulichen Beispiel für Studierende, Forschende und Interessierte, wie zirkuläres Bauen im Holzbau heute konkret umgesetzt werden kann.
Abbildung: Außenraum Werkhalle, Foto: Andreas Labes
Der Entwurf für das Werkstattgebäude wurde mit Studierenden entwickelt und verwirklicht. Die Anforderung, Teile des Gebäudes im Selbstbau zu realisieren, hat bei den Überlegungen hinsichtlich Bauteilabmessungen und Fügungen eine Rolle gespielt. Infolgedessen, konnte die Halle innerhalb weniger Monate von Studierenden, die durch einige wenige Fachkräfte angeleitet wurden, aufgebaut werden. Das Design-Build Projekt verknüpft so anhand des Konkret-Beispiels Entwurf, Ausführung und handwerkliches Können.
Abbildungen: Studenten und Fachleute beim Aufbau der Halle
Entwurf
Der neue Baukörper ist längs im Tal situiert und steht somit den existierenden Kaltluftströmen nicht im Weg. Der Eingang liegt der Villa Denis und dem bestehenden Parkplatz zugewandt. Mit dem ausgebildeten Vordach soll er den von hier startenden Wander *innen als Treffpunkt und Witterungsschutz dienen.
Zeichnungen: Ansicht Ost, Ansicht Nord
An den Längsseiten wird der einfache Baukörper über drei runde, prägnante, festverglaste Öffnungen belichtet. Die Stirnseiten bestehen aus transluzenten Polycarbonat-Stegplatten und sind zurückgesetzt, so dass der entstehende Dachüberstand sowohl als Aufenthalts- als auch als Lagerraum dienen kann. Durch den Rücksprung tritt die Form des Rahmentragwerks deutlich hervor und unterstreicht die Einfachheit des Gebäudes.
Abbildung: Fassade Werkhalle, Foto: Andreas Labes
Der Kern der Werk- und Forschungshalle ist ein multifunktionaler Raum: nutzbar für den Bau von großmaßstäblichen Versuchskörpern, sowie für Holzbau-Workshops, Seminare und Tagungen rund um die Forschungsthemen des t-labs. Die 360qm große Fläche ist flexibel möbliert und kann nutzungsspezifisch umgestaltet werden. Im Eingangsbereich werden weitere Räume (Lager, WC, Garderobe, Teeküche) in und um eine, frei im Raum stehende, Holzbox arrangiert.
Die Werk- und Forschungshalle ist so flexibel einsetzbar, dass sie zu verschiedenen Anlässen, verschiedene Nutzungen ermöglicht. Auch die feststehenden Holzbearbeitungsmaschinen sind so platziert, dass die Fläche frei bleibt. Finden Tagungen, oder größere Versammlungen statt, kann eine mobile Bühne vor dem Kern aufgebaut werden, die den im freien Mittelteil der Halle befindlichen Besucherplätzen eine freie Sicht auf das Geschehen gewährt. Geräte und die beweglichen Werkbänke werden entlang der Außenwände und um den Kern angeordnet.
Ebenfalls wird die Fläche der Halle als Ort für Lehrveranstaltungen, Projektpräsentationen und Seminare der RPTU Kaiserslautern-Landau, oder anderer Einrichtungen genutzt. Vor Ort vorhandene Möbel und Sitzgelegenheiten können je nach Bedarf angeordnet und genutzt werden.
Primär wird die Halle als Werk- und Forschungshalle betrieben. Die vorhandenen Maschinen und Werkbänke bieten Studierenden und Forschenden einen Ort und die Möglichkeit zur Konstruktion von Mock-Ups, Modellen und anderer Versuche.
Abbildung: Außenraum Werkhalle, Foto: Andreas Labes
Abbildung: Visualisierung der Tragstruktur
Tragwerk
Das Tragwerk der Halle bilden vorgespannte Dreigelenkrahmen, mit Gelenken an den Fußknoten und am First. Das Haupttragsystem besteht aus nebeneinanderliegenden, 12,50 m weit spannenden Rahmen aus Buchenfurnierschichtholz, die in einem Abstand von 2,50 m angeordnet sind.
Zeichnungen: Schnitte queer, längs
Die biegesteifen Traufknoten sind stabförmig aufgelöst, sodass eine effiziente Struktur aus Zug- und Druckstäben entsteht. Entsprechend ihrer Belastung werden die Stäbe mit zwei verschiedenen Querschnitten ausgeführt. Die innenliegenden schlanken Stäbe sind rein auf Druck belastet und knickgefährdet. Die Querschnitte betragen 160 x 200 mm. Die außenliegenden Stäbe, die auf Zug und Biegung belastet werden, werden mit einer Höhe von 300 mm und einer Breite von 160 mm ausgebildet. Ausgesteift wird das System durch Wand- und Deckenelemente aus Fichten-Brettsperrholz (BSP).
Animation: Darstellung Fügung tragender Bauteilgruppen
Alle Bauteile sind elementiert und reversibel verbunden, um einen späteren, einfachen Ausbau und einen darauffolgenden Wiedereinbau ohne Wertverlust zu garantieren.
Abbildungen: reversibel trennbarer Aufbau der Außenhaut
Außen folgt ein ebenfalls reversibler Wandaufbau: Weichfaserdämmebene, Konterlattung und vertikale Bretterschalung aus Douglasie. Statt einer klassischen Stahlbetonplatte wurde eine Brettsperrholz-Bodenplatte rückbaubar verbaut. Diese wurde nach dem Prinzip eines Kriechkellers auf Stahlprofilen aufgeständert, welche die Lasten materialminimiert, in die im Boden versenkten Mikropfähle leiten, die das Gebäude tragen.
Die einzelnen Elemente des Tragwerks, der Hülle und des technischen Ausbaus bleiben hierbei ablesbar und garantieren damit eine sortenreine Trennung.
Konusadapter
Abbildungen: Konusadapter: Modell, Einbau
Die kegelförmig gefrästen Konusadapter verbinden die Dach- und Wandelemente mit den Rahmen. Die aus Kunstharzpressholz gefertigten Verbinder sind dauerhaft, formstabil und hoch tragfähig.
Ringknoten aus Kunstharzpressholz
Für das Hallentragwerk der Holzhalle Diemerstein wurden neuartig organisch geformte Ringknoten aus Kunstharzpressholz entwickelt. Diese leiten sich von der natürlichen Formgestalt von Astgabeln (Zwieseln) ab. Zwiesel sind von Natur aus so proportioniert, dass Kräfte durch große Rundungsradien stetig umgelenkt werden. Im Gegensatz zur unstetigen Kraftumlenkung (Kerbe) entstehen dadurch keine Spannungssingularitäten mit Spannungsspitzen. Somit steigt bei gleichem Materialeinsatz die Leistungsfähigkeit. Mit einer organisch geformten und am Kraftfluss orientierten Knotengeometrie lassen sich statisch effiziente und zugleich architektonisch filigrane Bauteilanschlüssen realisieren.
Abbildung: Eingebaute Ringknoten auf der Baustelle
Die Ringknoten des Hallentragwerkes werden aus Kunstharzpressholz (KP) mit einer mittleren Dichte von 1350 kg/m³ gefertigt. Es handelt sich hierbei um einen Hochleistungsholzwerkstoff auf Basis technisch verdichteter Buchenfurniere. Diese werden zunächst mit Kunstharz imprägniert und anschließend unter hohem Druck und hoher Temperatur dauerhaft miteinander verbunden. Mit der Verdichtung steigt der Anteil der Holzfasern pro Volumeneinheit. Infolgedessen steigen die mechanischen Eigenschaften wie Festigkeit und Steifigkeit deutlich an. Für die Ringknoten wird auf KP mit kreuzweiser Orientierung der einzelnen Furnierlagen zurückgegriffen. Dadurch entstehen Holzwerkstoffplatten mit orthotropen, also gleichbleibenden Materialeigenschaften in X- und Y-Richtung. Da die Stärke der KP-Platten beim Verdichten auf ca. 70 mm begrenzt ist, wird die für die Ringknoten notwendige Stärke von 160 mm durch Verkleben von Teilplatten erreicht. Aus diesen werden die Bauteilknoten mittels CNC-5-Achsfräsen herausgefräst.
Animation: Fügung Ringknoten und Baubuchenstäben
Die Ringknoten sind so gestaltet, dass eine Verschraubung der Baubuchenstäbe über das Ringinnere mittels Muttern und Unterlegscheiben erfolgen kann. Dazu werden zunächst Gewindestäbe in die Stirnholzstöße der Baubuchenstäbe eingeführt und in Rechteckbolzen mit den Baubuchenquerschnitten verankert. Danach werden die Baubuchenstäbe mittels der Gewindestäbe nacheinander an die entsprechenden Knoten angeschlossen. Die für die Verbindung notwendige Schraubenvorspannung wird mittels eines Drehmomentschlüssels aufgebracht.
Die insgesamt vier verschiedenen Bauteilknoten der Hallenkonstruktion wurden parametrisiert, also mit Hilfe eigens entwickelter Computerprogramme entworfen. Dabei wurden geometrische Anforderungen für die Bauteilmontage ebenso berücksichtigt, wie architektonische und mechanische Aspekte.
Abbildung: Mockup und Detail Trauf- und Firstknoten
Die mittels des Gestaltungswerkzeugs der Parametrisierung entwickelten Ringknoten wurden im Weiteren mittels FE-Simulationen und unter Beachtung des orthotropen Materialaufbaus und der am jeweiligen Knoten maßgebenden Kraftsituation nummerisch validiert. Hierbei wurden Spannungsspitzen lokalisiert, die über die zur Verfügung stehenden Scriptparameter in einem iterativen Prozess kontinuierlich abgebaut wurden. Hierdurch wurde die Knotengeometrie kontinuierlich statisch optimiert.
Abbildung: Illustration Aufbau, Reversibilität